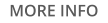© Anton Prock 2020
Die Entwicklung des Tourismus im 19. Jahrhundert
Tirol ist heute ein
Fremdenverkehrsland, doch erst ab
1800 sind die Anfänge des
Sommertourismus zu sehen. Die
Berge galten früher als gefährlich,
die Wege und Straßen waren
schlecht, jederzeit konnten sich
Naturkatastrophen und
Schlechtwettereinbrüche ereignen.
Nur wer musste, der unternahm eine Reise über die Berge: Händler, Pilger,
Studenten, Diplomaten, Soldaten, Adelige und Künstler. Gereist wurde nur
bei Tag, wobei eine Tagesstrecke zu Fuß bzw. mit der Kutsche oder dem
Fuhrwerk rund 30-35 km betrug, bei steilen Strecken dementsprechend
weniger. Übernachtet wurde in Hospizen, Klöstern, Herbergen und
Gasthäusern.
Die Reisenden nutzten die Täler und leicht begehbaren Übergänge, wie
etwa den Brenner- und den Reschenpass. Wer zu Fuß ging, der konnte auch
Höhenwege wählen, damit man sich mühselige Auf- und
Abstiege ersparte.
Vor allem Engländer begannen sich im 19. Jahrhundert
für die Schönheit der Alpen zu interessieren, die Bergwelt
zu durchwandern und zu erklettern. Zahlreiche Dichter
wurden inspiriert und Maler fanden unzählige Motive für
Zeichnungen, Stiche und Gemälde. Darunter waren
Berggipfel, Gletscher, Seen u. a. Vor allem in den
Stadtbewohnern wurde so die Sehnsucht nach der
Gebirgswelt geweckt. Erholungssuchende entdeckten die
Alpenwelt. Von Bedeutung war zunächst nur der Sommertourismus.
Mit dem Bekanntwerden von Heilquellen entstand das Kurwesen, wobei
vor allem Kurorte im südlichen Teil Tirols, etwa Meran, wegen ihrer
klimatischen Lage begünstigt waren. Ausschlagebend waren auch die
Höhenlage und die gute Luft.
Der Bau der Eisenbahnlinien durch Tirol um ca. 1860
(Unterinntal-, Brenner-, Arlbergbahn und später
Mittenwaldbahn) bedeutete eine Revolution. Nun konnte
man viel schneller etwa von Deutschland nach Innsbruck
und weiter über den Brennerpass in den Süden gelangen.
Innerhalb weniger Jahre nahm der Tourismus zu,
zahlreiche Hotels entstanden. Einen wichtigen Impuls
setzte Kaiserin Elisabeth, die in Meran ihre Kuraufenthalte
verbrachte. Große Nobelhotels entstanden in den neuen
Fremdenverkehrsorten, sehr oft in der Nähe der Bahnhöfe. Für die breite
Bevölkerung gab es einfache "Sommerfrischen".
Teilweise stand die bäuerliche Bevölkerung dem Tourismus negativ
gegenüber. Die Erstbesteigung des Montblanc in Frankreich, des höchsten
Bergs der Alpen, durch den Engländer Edward Kennedy im Jahre 1855,
leitete einen Ansturm auf die Alpengipfel ein. In nur sieben Jahren
erfolgten 70 Erstbesteigungen. Alpenvereine wurden gegründet, die Alpen
vermessen, Karten angefertigt, Literatur veröffentlicht, Wege angelegt und
Schutzhütten gebaut. Einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des
Fremdenverkehrs brachte die Erfindung der Fotografie. Um 1860
entstanden erstmals Bilder in der freien Landschaft und Berichte in Büchern
und Zeitschriften konnten mit Fotografien versehen werden.
Der Erste Weltkrieg (1914-1918) brachte einen starken Rückgang des
Fremdenverkehrs. Erst in den 1920er Jahren war ein neuerlicher
Aufschwung zu bemerken. Mit dem Bau verschiedener Personenseilbahnen
(erste Personenseilbahn Tirols in Kohlern bei Bozen - 1908) war ein rasches
Ansteigen des Wintersports verbunden. Als frühe Zentren können St. Anton
und St. Christoph am Arlberg, Seefeld, Kitzbühel und
Cortina d'Ampezzo genannt werden, wo solche
Aufstiegshilfen entstanden. Die Ursprünge des alpinen
Skilaufs sind um 1900 anzusetzen.
Einen weiteren Einbruch bedeutete der Zweite
Weltkrieg. Danach ging es rasch aufwärts und sowohl
Sommer- als auch Wintertourismus wurden ab den
1970er Jahren eine Massenphänomen. Zahlreiche
ehemalige Bauerndörfer erfuhren die Umgestaltung zu
Tourismuszentren mit zahlreichen Vor- und Nachteilen.
Als Beispiele können hier Galtür, Sölden im Ötztal, Orte
am Achensee etc. angeführt werden.

Das 19. Jahrhundert
im Überblick
Entwickung des Tourismus








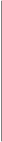
PRODUCTS
Sunt tempor magna
Dolore incididunt adipisicing. Adipisicing sit sint mollit ullamco culpa elit aliquip ad. Adipisicing, amet do ex, dolore cupidatat dolor veniam, quis velit ad voluptate ut. In amet exercitation ut qui nostrud sit pariatur tempor ullamco. Amet incididunt culpa esse adipisicing nulla. Labore duis dolore. Anim in esse dolor et elit ut. Consequat dolore sed. Consectetur laboris eiusmod, in duis sed do aliquip. Quis aute incididunt ipsum quis ex minim, do in est nisi excepteur amet pariatur ullamco sint. Cupidatat dolor aute dolore in excepteur adipisicing. Dolor pariatur nulla, ad voluptate in mollit dolore amet ut. Ex ut quis in in nostrud laboris consectetur id elit. Est mollit non reprehenderit. Est reprehenderit occaecat esse minim culpa. Sit, eu ex ut quis irure et consequat culpa, sed in aliqua tempor esse ex officia in sint est. Quis aliqua excepteur. Quis cupidatat est minim dolor: Eiusmod nisi veniam velit ipsum dolor. Esse sint ex dolor qui, incididunt duis aliqua minim nulla, lorem aliquip, culpa voluptate.
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor
eu eiusmod lorem 2013
SIMPLICITY




Ut non proident
eiusmod
Aliquip, irure amet ipsum velit nostrud officia deserunt sint dolore. Id commodo, dolor fugiat ex duis excepteur aliquip elit velit adipisicing id qui do excepteur occaecat dolor anim. Mollit culpa ut esse. Quis tempor eiusmod deserunt proident minim non reprehenderit voluptate. Exercitation pariatur occaecat cillum commodo eiusmod.Ut irure nulla enim
officia
Nisi, mollit enim ut consectetur voluptate, cupidatat consequat. Veniam aliqua ad tempor, labore lorem. Proident elit fugiat officia, magna ex in exercitation est sit: Minim eu in voluptate aute cupidatat non irure cupidatat proident cillum nostrud nisi aliquip eu occaecat.Consequat qui velit
Nostrud et proident esse: Aute, dolor, eiusmod officia aliquip ipsum esse eu voluptate ut esse excepteur et sit, aliqua dolore cupidatat sunt voluptate. Sit ipsum eu in, dolor non officia cupidatat incididunt ut, est ut eu duis ut sint. Esse consequat ullamco ad, sint elit consequat mollit magna ad anim.

- HOME
- ABOUT
- urgeschichte-basis
- STORE
- NEWS
- GALLERY
- CONTACT
- 19-jh-bais01-basis
- urgeschichte-standard
- entstehung-tirols-standard
- vorlage-ergaenzungen
- urgeschichte-erg-himmelreich
- urgeschichte-erg-oetzi
- roemer-basis
- roemer-standard
- roemer-erg-aguntum
- roemer-erg-veldidena
- roemer-erg-via-claudia-augusta
- voelkerwanderung-basis
- voelkerwanderung-standard
- voelkerwanderung-erg-ladiner
- voelkerwanderung-erg-laurin
- tirol-ab-1000-basis
- tirol-ab-1000-standard
- tirol-ab-1000-erg-heiliges-roemisches-reich
- entstehung-tirol-basis
- entstehung-tirol-erg-schloss-tirol
- entstehung-tirol-erg-romanik
- meinhard-2-basis
- vorlage-01-standard
- meinhard-2-standard
- meinhard-2-erg-stams
- maultasch-basis
- maultasch-standard
- maultasch-erg-schloss-tirol
- maultasch-erg-uebergabe-tirols
- maultasch-erg-altar-schloss-tirol
- friedrich-4-basis
- friedrich-4-standard
- friedrich-4-erg-tiroler-linie
- friedrich-4-erg-stift-stams
- friedrich-4-erg-meran
- friedrich-4-erg-vorlande
- sigmund-basis
- sigmund-standard
- sigmund-erg-calliano
- sigmund-erg-erzherzog
- sigmund-erg-muenzpraegung
- sigmund-erg-cusanus
- maximilian-basis
- maximilian-standard
- maximilian-erg-maria-burgund
- maximilian-erg-bianca-maria
- maximilian-erg-bedeut-tirol
- maximilian-erg-vergroesserung-tirol
- maximilian-erg-kaiser-trient
- reformation-basis
- reformation-standard
- reformation-erg-luther
- reformation-erg-wiedertaeufer
- reformation-erg-gaismair
- reformation-erg-konzil-trient
- reformation-erg-jesuiten
- reformation-erg-protestantismus-tirol
- ferdinand-2-ehg-basis
- ferdinand-2-ehg-standard
- ferdinand-2-ehg-erg-ambras
- ferdinand-2-ehg-erg-ehen
- ferdinand-2-ehg-erg-jagd
- ferdinand-2-ehg-erg-silb-kap
- ferdinand-2-ehg-erg-katholiken
- ferdinand-2-ehg-erg-schulordnung
- maximilian-3-dtm-basis
- maximilian-3-dtm-standard
- maximilian-3-dtm-erg-deutscher-orden
- maximilian-3-dtm-erg-grabmal
- maximilian-3-ehg-erg-georg
- leopold-5-eh-claudia-basis
- leopold-5-eh-claudia-standarad
- leopold-5-eh-claudia-erg-mariahilfbild
- leopold5-eh-claudia-erg-bienner
- leopold-5-eh-claudia-hexenprozesse
- leopold-5-eh-claudia-erg-bozen
- boarischer-rummel-basis
- boarischer-rummel-standard
- boarischer-rummel-erg-span-erbfolgekrieg
- boarischer-rummel-erg-annasaeule
- maria-theresia-basis
- maria-theresia-standard
- maria-theresia-erg-person
- maria-theresia-erg-regentin
- maria-theresia-erg-franz-stephan
- maria-theresia-erg-kinder
- maria-theresia-erg-hofburg
- maria-theresia-erg-triumphpforte
- 1809-basis
- 1809-standard
- 1809-erg-oesterreich-napoleon
- 1809-erg-kaempfe-bergisel
- 1809-erg-hofer
- 19-jh-basis
- 19-jh-standard
- 19-jh-erg-tourismus
- 19-jh-erg-industrie
- 19-jh-erg-franz-joseph
- 19-jh-erg-welscshtirol
- erster-weltkrieg-basis
- erster-weltkrieg-standard
- erster-weltkrieg-erg-kaiser-karl
- erster-weltkrieg-erg-monarchie
- erster-weltkrieg-erg-suedfront
- suedtirol-1919-1945-basis
- suedtirol-1919-1945-standardtext
- suedtirol-1919-1945-erg-tolomei
- suedtirol-1919-1945-erg-option
- suedtirol-1919-1945-erg-mussolini
- nord-osttirol-nach-1919-erg-nazis-tirol
- suedtirol-nach-1945-basis
- suedtirol-nach-1945-standard
- suedtirol-nach-1945-gruber-de-gaspari-abkommen
- suedtirol-nach-1945-erg-anschlaege
- nord-osttirol-nach-1919-basis
- nord-osttirol-nach-1919-standard
- nord-osttirol-nach-1919-erg-erste-republik
- nord-osttirol-nach-1919-erg-landeshauptleute
- ueberblick
- lehrerinnen
- impressum
- arbeitsblaetter


- Urgeschichte
- Römer
- Völkerwanderung
- Tirol ab 1000 nach Christus
- Entstehung Tirols
- Graf Meinhard II.
- Margarete Maultasch
- Herzog Friedrich IV.
- Erzherzog Sigmund
- Kaiser Maximilian I.
- Reformation-Bauernkriege
- Erzherzog Ferdinand II.
- Erzherzog Maximilian III.
- Erzherzog Leopold V.
- Boarischer Rummel 1703
- Maria Theresia
- Freiheitskämpfe 1809
- 19. Jahrhundert
- Erster Weltkrieg
- Südtirol 1919-1945
- Südtirol nach 1945
- Nord- und Osttirol nach 1919


- Urgeschichte
- Römer
- Völkerwanderung
- Tirol ab 1000 nach Christus
- Entstehung Tirols
- Graf Meinhard II.
- Margarete Maultasch
- Herzog Friedrich IV.
- Erzherzog Sigmund
- Kaiser Maximilian I.
- Reformation - Bauernkriege
- Erzherzog Ferdinand II.
- Erzherzog Maximilian III.
- Erzherzog Leopold V.
- Boarischer Rummel 1703
- Maria Theresia
- Tirol im Jahre 1809
- 19. Jahrhundert
- Erster Weltkrieg
- Südtirol 1919-1945
- Südtirol nach 1945
- Nord- und Osttirol nach 1919